
Das Turiner Grabtuch bei
Immanuel.at: ein Götzenbild? / Replik Herbert Röder 00, 2007-03-10
Das Turiner Grabtuch
/ Wikipedia-Enzyklopädie
Die Kollaps-Hypothese
/ Ergebnis der Forschungsgruppe um Prof. John Jackson aus Colorado Springs
Die Leinentücher und das
Schweißtuch / Replik Wolfgang Niemetz 00, 2007-04-02
Die drei Tage und drei Nächte
/ Replik Giuseppe De Candia 00, 2007-04-08
Wann kauften die Frauen die
wohlriechenden Öle?
Eine neue Sicht der "Karwoche"
Das Zeichen des Jona – Wie lange war Jesus im Grab? /
Buch Dr. Werner Papke
Tabelle – Die echte
"Karwoche" – tabellarische Übersicht über die Woche der Kreuzigung
Waren Abendmahl und
Kreuzigung am selben Tag? / Replik Walter Neumeier 00, 2007-09-11
Die Rekonstruktion des
Gesichts im TG / Morphing-Methode, Dennis Hooper, Zeitschrift
"Profil" vom 1995-01-23
Körperbild auf dem Turiner Grabtuch
ist nicht erklärbar / Studie der nationalen italienischen Energie- und
Umweltagentur. (ENEA)
Du weißt, daß ich eifriger Leser Deiner Auslegungen in
"Immanuel" bin. Doch eine Sache beschäftigt mich schon sehr, seit
dem Du ein Bild unseres angeblichen Herrn und Heilands in der Homepage
darstellst. In der Bibel, das zweite Gebot, welches die röm. katholische
Kirche ganz gestrichen hat, steht, daß wir uns kein Bildnis von Gott machen
sollen. Gerne höre ich Deine Meinung darüber, warum dieses Bildnis in
Deiner Homepage vorhanden ist. Heute beim Stöbern im Internet entdecke ich
eine Seite der Katholiken, in der aufgefordert wird, das Bildnis Jesu
unbedingt anzubeten!!! Ich frage mich nun, wenn Katholiken Deine Seite
aufschlagen und das Bild sehen, darin gestärkt werden es anzubeten und
somit Götzendienst betreiben in einer evangelikalen Homepage!!
Herbert-Roeder@t-online.de
Die nun hier im E-mail von H. Röder zitierte Website der
katholische Kirche ist tatsächlich ein typisches Beispiel für die katholische
Reliquienverehrung und Götzenanbetung.
Sie beten die Dämonen an, und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können.
Off 9,20 Und die übrigen der Menschen, die durch
diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer
Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen
und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder
sehen noch hören noch wandeln können. Off 9,20
Und es ist auch vollkommen richtig, dass die katholische Kirche
das zweite der zehn Gebote ihren Mitgliedern bis heute in betrügerischer
Absicht verschweigt. Nachdem es aber dadurch nur mehr neun Gebote wären, hat
man das zehnte Gebot in zwei Gebote aufgeteilt. Und so waren es wieder zehn.
(Siehe auch Diskurs 32: "Kommentar
zur Erklärung "Dominus Jesus" der katholischen Glaubenskongregation.")
Die katholische Kirche hat nun allen Grund, dieses zweite Gebot
zu vertuschen – beten sie doch in der katholischen Maria einen Götzen an und
betreiben in der Anrufung der katholischen "Heiligen" einen Totenkult,
welcher Gott ein Gräuel ist.
Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern wenden.
3Mo 19,31 Ihr sollt euch nicht zu den
Totengeistern und zu den Wahrsagern wenden; ihr sollt sie nicht aufsuchen,
euch an ihnen unrein zu machen. Ich bin der HERR, euer Gott. 3Mo 19,31;
Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen?
Jes 8,19 Und wenn sie zu euch sagen: Befragt die
Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so
antwortet: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die
Lebenden die Toten befragen? Jes 8,19;
Das zweite der zehn Gebote gebietet allen Gläubigen, sich keine
Götzenbilder, keine Abbilder von existierenden Dingen zu machen, um sich vor
ihnen niederzuwerfen und sie anzubeten.
Du sollst dir keinerlei Abbilder machen und sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen.
2Mo 20,3 Du sollst keine andern Götter
haben neben mir. – 20,4 Du sollst dir kein Götzenbild machen,
auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde
oder was in den Wassern unter der Erde ist: 20,5 du sollst dich vor ihnen
nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott,
bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den
Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, 20,6
der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben
und meine Gebote halten. 2Mo 20, 3- 6;
Wenn wir den Text genau lesen, erkennen wir, dass es bei diesem
Gebot nicht darum geht, dass sich die Gläubigen überhaupt keine Bilder machen
dürften. Sicher finden sich auch im Besitz von H. Röder einige Bilder – und
wenn es nur die Fotos seiner Familienmitglieder sein sollten.
Es steht hier auch nicht, dass wir uns "kein Bildnis von Gott machen sollen", wie H.
Röder oben schreibt, ganz im Gegenteil heißt es, "Du sollst keine andern
Götter haben neben mir". Es geht also ganz einfach darum, dass sich die
Menschen keine Götzenbilder machen und diese nicht anbeten und sich
nicht vor ihnen neigen sollen, wie z.B. das dauernde Kniebeugen der Katholiken
in ihrer Kirche vor allen möglichen Figuren und Bildern.
Und diesen Hintergrund
zeigt auch die möglichst originalgetreue Übersetzung dieses Gebotes aus dem
Hebräischen von Martin Buber ganz besonders deutlich:
Nicht mache dir Schnitzgebild, neige dich ihnen nicht,
diene ihnen nicht.
Namen (2Mo) 20,3-6 Nicht sei dir
andere Gottheit mir ins Angesicht. Nicht mache dir Schnitzgebild, – und alle
Gestalt, die im Himmel oben, die auf Erden unten, die im Wasser unter der Erde
ist, neige dich ihnen nicht, diene ihnen nicht, denn ICH dein Gott
bin ein eifernder Gottherr, zuordnend Fehl von Vätern ihnen an Söhnen, am
dritten und vierten Glied, denen die mich hassen, aber Huld tuend ins tausendste
denen die mich lieben, denen die meine Gebote wahren. Namen (2Mo) 20, 3- 6;
Obwohl diese Interpretation also von der Logik und der Realität
her – es hat immer schon Bilder gegeben – nicht in Zweifel zu ziehen ist, kann
hier bei Geschwistern mit einseitiger Hintergrundinformation ein falsches
Grundverständnis auftreten. Unterstützt wird dies auch noch von manchen
Übersetzungen – wie z. B. Elberfelder und King James – welche
am Ende von Vers4 den Satz beenden und im Vers 5 einen neuen Satz beginnen.
Dadurch geht die Zusammengehörigkeit dieser beiden Aussagen verloren und
jeder Satz – insbesondere 2Mo 20,4 – wird fälschlicherweise
als eigenes Gebot isoliert betrachtet.
Elberfelder Bibel:
2Mo 20,4 Du sollst dir kein Götterbild machen,
auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde
oder was in den Wassern unter der Erde ist. –
20,5 Du sollst dich vor
ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. 2Mo 20, 4- 5;
Manche deutsche und englische Übersetzungen (z.B. Luther, Darby) behelfen sich mit einem Doppelpunkt am Ende von Vers 4 um die Zusammengehörigkeit dieser Texte hervorzuheben. Doch die richtige Lesart dieser Passage lautet:
2Mo 20,4 Du sollst dir kein Götterbild
machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der
Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist: 20,5 und dich nicht vor ihnen
niederwerfen und ihnen nicht dienen. 2Mo 20, 4- 5;
Wir sollen uns also kein Bild machen, um uns vor ihm
niederzuwerfen und es anzubeten. Ein Bild, welches nicht angebetet wird und zu
dessen Anbetung nicht aufgefordert wird, ist also kein Götzenbild und
verstößt daher auch nicht gegen das zweite Gebot. Diese Sicht wird aber auch
durch konkrete Beispiele in der Bibel bestätigt.
Alle jene Geschwister welche
meinen, das zweite Gebot würde überhaupt verbieten Bilder oder Skulpturen zu
machen, sei eine Lektüre von 2Mo 25 empfohlen. Dort bekommen die Israeliten den
Auftrag u.a. den Deckel für die Bundeslade zu machen. Und dort heißt es:
Und mache zwei goldene Cherubim; in getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte.
2Mo 25,17 Dann sollst du eine Deckplatte aus reinem
Gold herstellen: zweieinhalb Ellen sei ihre Länge und anderthalb Ellen ihre
Breite. 25,18 Und mache zwei goldene Cherubim; in getriebener Arbeit sollst
du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte, 25,19 und zwar sollst du
einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Aus einem
Stück mit der Deckplatte sollt ihr die Cherubim machen an ihren beiden Enden.
25,20 Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte
mit ihren Flügeln überdeckend, während ihre Gesichter einander zugewandt
sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. 2Mo
25,17-20;
Hier mussten die Israeliten zwei Cherubim – also zwei
Engel und damit Himmelgestalten – machen. Und der Auftrag kam von Gott
dem Allmächtigen. Es ist also nicht denkbar, dass Gott in 2Mo 20,4-5 ein Gebot
erlässt, in dem Bilder und Skulpturen (Schnitzgebild) grundsätzlich verboten
würde und dann in 2Mo 25,17-20 den Israeliten gebietet, zwei Engel aus
getriebenem Gold zu machen.
Wie so oft im christlichen Glauben, ist nicht das maßgeblich was
wir vor Augen haben, sondern das, was wir im Kopf haben. Und hier kann es
natürlich durchaus Unterschiede geben.
Damit steht aber fest: im zweiten Gebot Gottes ist nicht das "Abbild" das
Kriterium, sondern das "Anbeten". Erst dann, wenn Menschen diesem Bild
dienen und sich vor ihm niederwerfen, sind sie Götzenanbeter und Gott ein
Gräuel. Eine solche Situation finden wir dann ebenfalls beim Volk Israel, in
2Mo 32,1. Mose war bei Gott auf dem Sinai um die zwei Tafeln des Gesetzes zu
empfangen und seine Rückkehr verzögerte sich.
Auf! Mache uns Götter, die vor uns herziehen!
2Mo 32,1 Als nun das Volk sah, daß Mose säumte,
vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron, und sie sagten zu
ihm: Auf! Mache uns Götter, die vor uns herziehen! Denn dieser Mose, der
Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, – wir wissen nicht, was
ihm geschehen ist. 2Mo 32, 1;
Obwohl Gott den Israeliten mehr als genug Beweise seiner Gnade
und Freundlichkeit erwiesen hat, hatten sie sehr schnell die Treue zu ihrem Gott
über Bord geworfen und sich einen Götzen gemacht. Interessanterweise ist hier
eine gewisse Ähnlichkeit zum Verhalten der katholischen Kirche in unseren Tagen
zu erkennen.
Auch dort sagte man sich "Auf! Lasst uns einen Götzen machen",
als man per Dogma des "unfehlbaren" Papstes im Jahre 1931 die katholische
Maria zur "Mutter Gottes" und "Himmelskönigin" dekretiert und bald
darauf, im Jahre 1950, auch die "Himmelfahrt der Jungfrau Maria" zum Dogma
erhoben hat.
Damit hatte man in der katholischen Kirche praktisch diese Maria
als "die Muttergottes" in eine hierarchische Ebene über den Sohn, unseren
Herrn erhoben und spricht hinfort von ihm nur mehr als vom "Jesuskind".
Bereits 1854 hatte man ja die "unbefleckte Empfängnis Marias" erfunden –
was sich nicht etwa auf die jungfräuliche Geburt unseres Herrn bezieht, sondern
darauf, dass Anna, die Mutter Marias, nach katholischer Lehre diese
ebenso unbefleckt und jungfräulich und durch den Heiligen Geist empfangen haben
soll, wie Maria den Herrn.
Daher blieb nun als einziger Makel nur mehr der
fehlende Nachweis der leiblichen Himmelfahrt Marias, welcher dann mit dem Dogma
von 1950 endlich auch beseitigt war, sodass der Götze Maria in der katholischen
Kirche dem Sohn Gottes quasi gleichgestellt ist.
(Siehe auch Diskurs 78: "Die
katholische Lehre und die Bibel –
eine Disputation.")
Wir sehen also, dass die katholische Kirche keine Lüge und
keinen Betrug scheut, um ihrem Götzen –
und damit natürlich sich selbst –
zu
Macht und Ruhm zu verhelfen. Und daher wäre es auch durchaus denkbar, dass man
dort eines Tages auf die Idee kommt, den Herrn Jesus als das "Lamm Gottes" –
wie er ja auch in der Schrift bezeichnet wird –
zu verehren und anzubeten.
Würde mich dann H. Röder auffordern, das Bild am Beginn der Startseite von
meinen Schafen und Lämmern auf der Weide auch zu entfernen, weil sonst
irgendwelche Katholiken "darin gestärkt werden es anzubeten"?
Oder wenn wir uns die Stellung des Koran im Islam ansehen: Das heilige Buch der
Muslime wird dort als direkt "vom Himmel herab gegeben" bezeichnet und
verehrt und geküsst. Nachdem nun auch Papst Johannes Paul II. am 14. 5. 1999
bereits den Koran geküsst hat, wäre es durchaus denkbar, dass die katholische
Kirche auch die Bibel verehren und küssen lässt.
Würde H. Röder dann
fordern, dass ich das Bild von einer Bibel auf der Willkommenseite von
Immanuel.at lösche? Und wie wäre es dann mit dem Lesen der Bibel? Dürften wir
das dann nach Meinung der obigen Kommentatoren noch? Oder würden sie dann auch
die Bibel zu einem "falschen Gotteswort" und einem "antichristlichen Buch"
erklären, nur weil sie die katholische Kirche zu einer Reliquie deklariert?

Wie man sieht, führen derartige Ansichten zu vollkommen
falschen Interpretationen. Eine ähnliche Geisteshaltung mögen die Inquisitoren
der katholischen Kirche gehabt haben, als sie unter dem Vorwand, die Kirche vor
Häretikern schützen zu müssen, rechtgläubige Christen verfolgt und gefoltert
haben und wenn diese ihrem Glauben nicht abschwören wollten, sie am
Scheiterhaufen verbrannt haben.
Im Unterschied zur katholischen Lehre, welche
sich auf ihre mündliche und schriftliche Tradition beruft und die Bibel als
zweitrangig erklärt, gründet sich die Lehre der bibeltreuen Christen
ausschließlich auf die Bibel und hier insbesondere auf die Aussagen unseres
Herrn Jesus Christus.
Daher gibt es hier keine unbiblischen Heiligen, Reliquien,
Brotverwandlungen und Götzenverehrungen, sondern wir beten in Geist und
Wahrheit zu Gott dem Allmächtigen und unserem Herrn Jesus Christus.
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Jh 4,21 Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es
kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, noch in Jerusalem den Vater
anbeten werdet. 4,22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir
kennen, denn das Heil ist aus den Juden. 4,23 Es kommt aber die Stunde und
ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden;
denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. 4,24 Gott ist Geist,
und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jh 4,21-24;
Und wir beten auch nicht öffentlich vor den Leuten und in den
Kirchen, wie das die Heuchler tun. Sie haben bereits ihren Lohn in der
Beachtung, die ihnen die Menschen dadurch zollen. Wir aber gehen zum Beten in
unsere Kammer, schließen die Tür und beten zu unserem Vater im Himmel, der im
Verborgenen ist.
Wir plappern auch nicht und ratschen zehn "Ave Marias" oder
Bittgebete an irgendwelche Heilige herunter, sondern wir sprechen zu unserem
Gott und unserem Herrn Jesus Christus ungekünstelt, aber in Demut und
Aufrichtigkeit, bedanken uns ganz konkret für das, was wir schon erhalten haben
und bitten um das, was wir noch denken zu benötigen.
Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist!
Mt 6,5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie
die Heuchler; denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen
stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage
euch, sie haben ihren Lohn dahin. 6,6 Wenn du aber betest, so geh in deine
Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im
Verborgenen ist! Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten.
6,7 Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn
sie meinen, daß sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Mt 6, 5- 7;
Würden wir zum Beten in eine Kirche gehen, würden wir Gefahr
laufen, den echten Tempel Gottes, der wir selbst sind, zu entehren. Gott finden
wir nicht in Kirchen und öffentlichen Gottesdiensten, sondern in unserem Geist
und in der Stille und Abgeschiedenheit unserer Kammer. Wer die Bilder und
Figuren in den Kirchen anbetet, betet Götzen an. Und welchen Zusammenhang haben
wir, als Tempel Gottes, mit den Götzenbildern?
Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, er wird uns Vater sein und wir werden ihm Söhne und Töchter sein.
2Kor 6,16 Und welchen Zusammenhang hat der
Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes;
wie Gott gesagt hat: «Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde
ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein.» 6,17 Darum geht aus ihrer
Mitte hinaus und sondert euch ab! spricht der Herr. Und rührt Unreines
nicht an! Und ich werde euch annehmen 6,18 und werde euch Vater
sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der
Allmächtige. 2Kor 6,16-18;
So hat das auch Gottfried Daniel Pomacher, ein
Erweckungsprediger aus dem Wuppertal gesehen, als er sagte:
"Das Christentum besteht nicht in Worten sondern in der Kraft des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Nicht jene sind die Säulen des Tempels, die sich öffentlich in Gebeten mit "Herr, Herr" die Bewunderung ihrer Zuhörer verschaffen, sondern jene, welche zuhause, in ihrem stillen Kämmerlein und ohne einen einzigen Zuhörer, ihre Gebete an den Herrn richten, sind die wahren Träger der Gemeinde."
Und nun spricht das zweite der zehn Gebote davon, dass wir uns
keine Götzenbilder machen sollen. Doch ebenso, wie ein Mensch erst dann
gerettet ist, wenn er zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gekommen ist –
und nicht vorher –
, wird ein Bild (oder ein Mensch, ein Tier / Röm 1,22-23)
erst dann zum Götzen, wenn es angebetet und verehrt wird.
Es heißt daher in
diesem Gebot nicht, dass wir uns überhaupt keine Bilder von den Dingen im
Himmel, auf Erden und unter Wasser machen sollen, sondern dass wir uns keine Bilder
zum Anbeten machen sollen, weil dies Götzendienst wäre. Dass dies in
anderen Religionen und Kirchen geschieht, liegt in der Verantwortlichkeit jener
Menschen, welche sich dazu bekennen und nicht in unserer.
Als bibeltreue Christen beten wir weder Bilder noch Figuren an und beten auch
nicht in der Öffentlichkeit, sondern in der Gebetsintimität unserer Kammer.
Und wie jedes andere Bild kann auch das Bild des Turiner Grabtuchs auf der
Willkommensseite von Immanuel.at nicht gegen das zweite Gebot verstoßen, solange
dort nicht aufgefordert wird dieses Bild zu verehren und anzubeten. Zudem haben
wir dort ganz im Gegenteil als Kommentar zu diesem Bild den ausdrücklichen
Hinweis:
Ob das Turiner Grabtuch echt ist und wie Jesus
Christus tatsächlich ausgesehen hat, ist für uns gläubige Christen völlig
ohne Belang. Wir lieben ihn, weil er unser Herr, Gott und Erlöser ist. Weil er
für uns am Kreuz gestorben ist, um unsere Sünden vor dem Vater zu sühnen. –
Und weil er auferstanden ist und uns damit den Weg gezeigt hat, den auch wir
gehen werden.
Allein aus diesen vier Sätzen könnte auch ein Katholik das
wahre Evangelium erkennen. Wenn er dann in seine Kirche zurückkehrt und dort
weiter die toten "Heiligen" und den Götzen Maria anbetet, wird es ihm nach
der Verheißung des Herrn in Jh 3,36 ergehen:
Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Jh 3,35 Der Vater liebt den Sohn und hat alles
in seine Hand gegeben. 3,36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben;
wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der
Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jh 3,35-36;
Was nun das von Herbert Röder monierte "Bild unseres
angeblichen Herrn und Heilands" auf dem Turiner Grabtuch betrifft, haben wir
in der Schrift u.a. die Aussage des Johannes, dass er und Petrus das Grab, in
das der Herr gelegt wurde, leer vorfanden und darin nur die Leinentücher liegen
sahen, in welche ihn Josef von Arimathäa drei Tage zuvor eingewickelt hatte (Mt
27,57-61).
Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen.
Jh 20,3 Da ging Petrus hinaus und der andere
Jünger, und sie gingen zu der Gruft. 20,4 Die beiden aber liefen zusammen, und
der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der
Gruft; 20,5 und als er sich vornüberbückt, sieht er die Leinentücher
daliegen; doch ging er nicht hinein. 20,6 Da kommt Simon Petrus, der ihm
folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen 20,7
und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den
Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen
Ort. 20,8 Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der
Gruft kam, und er sah und glaubte. Jh 20, 3- 8;
Auch das Grabtuch von Turin ist ein Leinentuch, in welchem ein
gekreuzigter Mensch eingewickelt war. Eine objektive Beurteilung darüber finden
wir in der unbestritten weltlich orientierten Online-Enzyklopädie Wikipedia:
Unumstritten ist, dass es sich bei dem Tuch um eine Singularität
handelt, und zwar vor allem durch folgende Eigenschaften:
Die Abbildung ist verzerrungsfrei nach Art einer
fotografischen Projektion auf eine plane Fläche, also kein
Kontaktabdruck. Trotzdem zeigt sie Vorder – und Rückseite der
abgebildeten Person in voller und identischer Größe.
Die Abbildung ist nach Helligkeitsparametern ein Negativ.
Erst neuzeitliche fotografische Technik erlaubt die Umkehrung, die
ein stufenlos abgeschattetes, vollkommen realitätsechtes "Schwarzweißfoto"
ergibt. Die Entstehung durch Malerei ist damit ausgeschlossen.
Die Abbildung zeigt bzw. fingiert einen nach Art
Jesu gekreuzigten Mann mit Spuren von Geißelung, Dornenkrönung,
Annagelung und Brustöffnung. Auffällig ist jedoch, dass die
Details, von der christlichen Ikonografie abweichend, mit den
Ergebnissen moderner archäologischer Forschung übereinstimmen: die
Spuren der Dornenkrone ergeben keinen Kranz, sondern eine Haube (im
Orient war die Dornenhaube üblich und eine Dornenkrone unüblich);
die Hände erscheinen nicht in der Fläche, sondern an der Wurzel
durchbohrt; die Beine müssten am Kreuz seitlich angewinkelt, nicht
ausgestreckt gewesen sein.
Auszug aus Wikipedia-Turiner
Grabtuch
Auf den Augen des Menschen sind Abdrücke von Münzen aus
der Zeit des Pontius Pilatus zu erkennen. Ebenso spricht die Pollenanalyse
für eine Datierung zur Zeit Jesu, die Radio-Carbon-Methode kann für eine
Datierung nicht benutzt werden, da das Tuch öfters Bränden ausgesetzt war,
welche den Carbonwert verändert haben.
Diese konnte bis jetzt noch nicht endgültig verneint
werden, alle Versuche, das Tuch ins Mittelalter zu datieren, sind
gescheitert.
Auszug aus http:/www.theologiewiki.de/Turiner_Grabtuch
Nach dem Urteil der Fachleute, welche sich seit Jahrzehnten mit
der wissenschaftlichen Untersuchung des Turiner Grabtuches befasst haben, kann
also die Echtheit des Tuches bisher nicht verneint werden. Man würde sich
wünschen, dass es im Zusammenhang mit der Schöpfungslehre auch einen ähnlich
objektiven wissenschaftlichen Befund geben würde.
Die Behauptung zu Beginn dieser Untersuchungen, dass es sich hier um eine zwar
großartig ausgeführte, aber dennoch um eine Malerei handeln würde, konnte
durch die aktuellsten fototechnischen Methoden nunmehr ohne Zweifel widerlegt
werden. Auch die oftmals zitierte Datierung des Tuches ins Mittelalter anhand
der 14C-Datierung (Radiokarbonmethode/"Kurzzeituhr") hat sich
aufgrund der Brandeinwirkungen auf dem Tuch als unbrauchbar erwiesen.
Was zudem die Glaubwürdigkeit des Turiner Grabtuches in hohem Ausmaß stützt,
ist einerseits der Umstand, dass die Christusbilder der vergangenen Jahrhunderte
die Wunden von den Nägeln an den Händen in der Handfläche (Handteller)
abbildeten, während das Turiner Grabtuch diese Wundmale in der Handwurzel
aufweist.
Dies ist aber auch genau jene Position, welche in der modernen
archäologischen Forschung bei Ausgrabungen von gekreuzigten Menschen aus dieser
Zeit vorgefunden wurde. Andererseits haben die Münzexperten Prof. Filas
(Chicago) und Prof. Whanger (Durham) die beiden Münzabdrücke auf den Augen als
Prokuratorenmünzen identifiziert.
Sie stammen von einer Kupfermünze,
die Pilatus zwischen 28 und 30 n. Chr. prägen ließ und die nach der
Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nicht mehr im Umlauf war. Diese ist in
mehreren Prägungen bekannt und trägt die Inschrift "TIBERIOU KAISEROS"
(Kaiser Tiberius). Nur Anno 29 unterlief dem Münzmeister ein Fehler.
Er schrieb
KAISEROS mit C anstatt eines K. Genau jene seltenen Münzen sind es, deren
Abdrücke auf dem Grabtuch eindeutig identifiziert werden konnten.

Prokuratorenmünze: Rechts die rekonstruierte
Inschrift UCAI und der Hirtenstab
(aus https://www.huinfo.at/grabtuch/default.html)
Lässt man einmal die für die Wissenschaft unerklärbare
Entstehung dieses Abbildes außer Betracht, könnten alle diese Einzelheiten –
die Abdrücke auf den Augen von Münzen aus der Zeit des Pontius Pilatus, die
Spuren von Geißelung, die Wunden von den Nägeln und die Wunde in der Brust –
im Prinzip auch von einem anderen Gekreuzigten aus der Zeit um etwa 30 unserer
Zeitrechnung stammen.
Was allerdings kaum bei einem von Pilatus gekreuzigten
Verbrecher zu erwarten ist, ist eine Dornenhaube. Dabei geht es hier gar nicht
so sehr um den Fakt, dass man im Orient auf den Christusbildern üblicherweise
eine Dornenhaube abbildete und keinen Dornenkranz wie in westlichen Ländern,
und das Turiner Grabtuch ebenfalls eine Dornenhaube aufweist, sondern es geht
viel mehr um die biblische Tatsache, dass Jesus Christus diese "Krone" von
den römischen Soldaten deshalb aufgesetzt wurde, um ihn zu verhöhnen, weil er
sagte, er sei der König der Juden.
Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst es.
Mt 27,11 Jesus aber wurde dem Statthalter
vorgeführt. Und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König
der Juden? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst es. Mt 27,11;
Jesus wurde von den Hohenpriestern und Ältesten mit der
Begründung an Pontius Pilatus ausgeliefert, dass er von sich behauptete, der
König der Juden zu sein. Und als Pilatus ihn verhörte und keine Schuld an ihm
fand, wollte er ihn wieder freigeben. Doch die Juden schrien und drohten sogar
Pilatus, er sei kein Freund des Kaisers, wenn er Jesus wieder freigeben würde.
Die Juden aber schrien und sagten: jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser.
Jh 19,12 Daraufhin suchte Pilatus ihn loszugeben. Die
Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers
Freund nicht; jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem
Kaiser. Jh 19,12;
Die Aussage des Herrn, er sei der König der Juden und der Hass
der Juden auf diesen Jesus von Nazareth war also der offizielle Grund, warum
Pilatus ihn zum Tod am Kreuz verurteilt hat. Als Jesus dann den Soldaten
übergeben wurde, geißelten und verspotteten sie ihn, indem sie ihm einen
scharlachroten Mantel umhängten, eine Dornenhaube flochten und ihm auf das
Haupt setzten und dann vor ihm auf die Knie fielen und riefen: Sei gegrüßt,
König der Juden.
Sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden!
Mt 27,27 Dann nahmen die Soldaten des Statthalters
Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar; 27,28 und
sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. 27,29 Und
sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm
ein Rohr in seine Rechte; und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten
ihn und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! 27,30 Und sie spien ihn an,
nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. 27,31 Und als sie ihn verspottet
hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an; und
sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Mt 27,27-31;
Und genau das ist nun der springende Punkt: Nachdem eine
künstliche Herstellung des Turiner Grabtuchs aufgrund der oben zitierten
wissenschaftlichen Befunde nicht nachgewiesen werden kann und man die
Identifikation mit Jesus von Nazareth nicht wahrhaben will, bleibt aufgrund der
Indizien nur die Alternative, dass es sich hierbei um einen anderen gekreuzigten
Menschen aus der Regierungszeit des Pilatus handeln würde.
Doch es ist so gut wie ausgeschlossen, dass irgendein gekreuzigter Verbrecher der damaligen Zeit
als "König der Juden" verhöhnt und ihm eine Dornenkrone aufgesetzt worden
wäre, wie es das Turiner Grabtuch zeigt. So gesehen wäre also gerade diese
Verhöhnung des Sohnes Gottes durch die römischen Soldaten, Jahrtausende
später für die ungläubige Welt zum historischen Nachweis für seine Existenz,
seinen Tod und seine Auferstehung geworden.
Ein ungelöstes Problem war lange Zeit die Tatsache, dass sich die Abbildung
verzerrungsfrei nach Art einer fotografischen Projektion auf eine plane Fläche
darstellt und somit kein Kontaktabdruck sein kann. Trotzdem zeigt sie Vorder‒
und Rückseite der abgebildeten Person in voller und identischer Größe.
Bei
jedem Kontaktabdruck müssten die Umrisse des Bildes verzerrt sein, weil durch
die Topologie des menschlichen Körpers z.B. die Seitenabdrücke des Gesichts
auf dem dann plan aufgelegten Tuch das Gesicht verbreitert darstellen würden.
Dies hat eine Forschungsgruppe um John Jackson, Professor für theoretische
Physik aus Colorado Springs, untersucht, welcher Mitglieder aus so bedeutenden
Institutionen wie der NASA, dem Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, der
Wright Patterson Air Force Base, IBM, dem Santa Barbara Research Center, der
N.U.T.E.K., dem Sandia National Laboratory in New Mexico, der Nuclear Technology
Corp., der Lockheed Missiles and Space Corp., dem Los Alamos National Laboratory
und anderer angehörten.
Die Entwicklung der Computer-Bildanalyse-Technologie
brachte Jackson auf die Idee, diese Technik auch am Turiner Grabtuch
auszuprobieren.
Er interessierte Donald Devan vom Informations Science Institute in Santa
Barbara und Dr. Eric Jumper, einen Air Force Officer und Physiker für das Tuch.
In jeder freien Minute studierten nun Jackson, Jumper und weitere
Wissenschaftler Grabtuchfotos, die 1931 und 1973 gemacht worden waren.
Sie
untersuchten die Bilder mit dem VP-8-Bildanalysator, einem hochentwickelten
Gerät, das die Bildintensität in ein vertikales Relief umwandeln kann. Zu
ihrer Überraschung fanden sie, daß das Bild auf dem Tuch genaue
dreidimensionale Daten enthält, was bei herkömmlichen Photographien und
Gemälden nicht der Fall ist. Mittels der Computerdaten konnten sie ein
dreidimensionales Modell des Abbildes konstruieren.
(...) es ergaben sich weitere spektakuläre Ergebnisse. Eine
unbekannte Strahlung als Auslöser der Bildentstehung war die einzige
Theorie, die nach all den neuen Forschungsergebnissen stand hielt, und Prof.
Jackson brachte den Knüller: die Kollaps- oder Tuchzusammenfall-Hypothese.
Die Auswertung sämtlicher 1978 und früher sowie später gewonnener Daten
schien nur noch eine Möglichkeit zuzulassen:
Im Moment der Strahlung fiel die auf dem Körper liegende Tuchhälfte in die
Region hinunter, in der einen Moment zuvor noch der Körper gelegen hatte.
Die Bildspuren entwickelten sich genau zu dem Zeitpunkt, als diese Strahlung
auftrat und das Tuch zusammenzusinken begann. Das hatte auf dem Bild
Verzerrungen und Nichtübereinstimmungen von Körper- und Bildmerkmalen
sowie den Blutflecken zur Folge sowie die Abwesenheit von Seitenbildern. Die
Ränder von Auge und Wange z.B. scheinen nach aussen ins Leere zu gleiten.
Diese Merkmale – die Verzerrungen, Nichtübereinstimmungen und das
Verschwimmen der Seitenbilder – waren Ergebnisse der Forschungen von
Wissenschaftlern auf den Gebieten der Medizin, Anatomie, Bildanalyse und
zahlreicher anderer, und diese Ergebnisse ergaben erst durch Jacksons
Kollaps-Hypothese einen Sinn. Dieses Konzept eines in die darunterliegende
Körperregion hineinfallenden Tuches mit gleichzeitiger Entstehung des
Bildes erfordert im wesentlichen folgende Annahmen:
o Der Körper wurde mechanisch "durchlässig"
für sein physikalisches Umfeld – oder er verschwand im Augenblick –
oder er wurde in Energie verwandelt.
o Es muss einen Auslöser gegeben haben, der
das Verschwinden des Körpers bewirkte und gleichzeitig den Niederfall des
Tuches in die nun leere Körperregion als "Bild" aufzeichnete.
Es ist bislang absolut unklar, welcher physikalischer Natur
dieser Auslöser gewesen sein könnte. Was (oder wer?) könnte einen solchen
Prozess verursacht oder durchgeführt haben, von dem wir zumindest wissen,
dass er aus einer Art Strahlung resultierte? Es gibt drei Möglichkeiten:
o Ein übernatürlicher, göttlich bewirkter
Vorgang = ein für uns unerklärbares Wunder.
o Ein wissenschaftlich erklärbarer Vorgang
von uns noch unbekannter Natur.
o Ein wissenschaftlich erklärbarer
technologischer Eingriff durch eine fremde, uns überlegene Intelligenz.
Jackson selbst sagte zu diesem überraschenden
Forschungsergebnis: "Als Physiker gebe ich zu, dass auch ich meine
Schwierigkeiten habe mit diesem Konzept, doch ich weiss auch, dass wir
Wissenschaftler bereit sein müssen, unsere heiligsten Prinzipien
umzustürzen, falls die Beobachtungen das erfordern... Manche Forscher und
Laien nehmen stillschweigend an, dass es wohl noch eine verborgene Seite der
Natur gebe, die bislang nicht beobachtet oder studiert wurde von der
modernen Wissenschaft, oder die sich, aus welchem Grund auch immer, zum
ersten Mal zeigte, als das Tuchbild entstand. Natürlich kann man leicht
behaupten, dass das Bild auf dem Tuch durch einen einzigartigen, sich nicht
wiederholenden Prozess gebildet wurde. Vielleicht war es so. Doch das würde
die Diskussion von jeder wissenschaftlichen Untersuchung entfernen, weil
Wissenschaftlichkeit sich durch den Begriff der empirischen Wiederholbarkeit
auszeichnet."
Durch einen unbekannten Eingriff wurde durch eine noch unbekannte Strahlung
gleichzeitig der Körper entweder physikalisch durchlässig oder im
Augenblick entfernt oder in Energie verwandelt sowie durch diesen Prozess
die Zellulose der Faserspitzen des Tuches über und unter dem Körper
verändert, so dass eine Art Bild entstand, eine Art Verbrennung oder
Versengung. Hier wird die High Tech-Grabtuchforschung interessant für die
Exegeten, die meinen, die mysteriöse Auferstehung sei der verursachende
Faktor gewesen. Wo die kirchliche Neugierde aufhört, fängt jedoch die
wissenschaftliche erst richtig an. Und unter diesem Aspekt wird das Turiner
Grabtuch auch für die Paläo-SETI-Forschung interessant:
Da der im Tuch liegende Körper definitiv tot war und sich z.Z. der
Bildentstehung und des rätselhaften Strahlungsvorganges bereits in
Leichenstarre befand (was eines der sichersten Ergebnisse von hundert Jahren
Grabtuchforschung ist und über das sich die Mediziner völlig einig sind),
ergibt sich eine wichtige Frage: Wer war der Verursacher dieses Prozesses?
Was ist eher vorstellbar: ein übernatürliches Wunder, ausgeführt durch
einen toten Körper in Leichenstarre – oder ein kontrollierter Eingriff,
durchgeführt durch einen uns unbekannten Verursacher mittels Strahlung, die
das Verschwinden oder physikalisch "durchlässig" werden des toten
Körpers zur Folge (oder zum Ziel?) hatte?
Auszug aus der Website Das Turiner Grabtuch
Der Hauptgrund, warum nun halbwegs objektive weltliche
Wissenschaftler das Abbild im Turiner Grabtuch nicht als Falsifikat einstufen
können, ist die Unmöglichkeit, die Art und den Hintergrund seiner Entstehung
wissenschaftlich empirisch nachzuweisen. Eine Problemstellung, welche wir, als
bibelkundige Christen möglicherweise aufklären könnten.
In 1Kor 15,51-53
schreibt Paulus den Korinthern über die Auferweckung der Toten bei der
Wiederkunft des Herrn und er vertraut ihnen ein Geheimnis an:
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: wir werden alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick.
1Kor 15,51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden,
15,52 in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn
posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein,
und wir werden verwandelt werden. 15,53 Denn dieses Vergängliche muß
Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen.
1Kor 15,51-53;
Wie Paulus schreibt, werden die Toten in Christus bei der
Wiederkunft des Herrn zur Entrückung auferweckt und in einem Nu, in einem
Augenblick, verwandelt werden und unvergänglich sein. Auf diese Verwandlung
bezieht er sich dann auch im seinem zweiten Brief an die Korinther, wo er
gesteht:
Wir sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden.
2Kor 5,1 Denn wir wissen, daß, wenn unser
irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit
Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. 5,2 Denn in diesem freilich
seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel
überkleidet zu werden, 5,3 insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden
werden. 5,4 Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil
wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das
Sterbliche verschlungen werde vom Leben. 2Kor 5, 1- 4;
Und hier schreibt Paulus, dass er sich danach sehnt noch
lebendig mit der "Behausung aus dem Himmel" –
dem Geistleib –
überkleidet
zu werden, anstatt zuerst zu sterben –
also entkleidet – und erst
später, bei der Wiederkunft des Herrn, auferweckt und zur Gleichgestalt mit
dessen Leib der Herrlichkeit überkleidet zu werden.
(Siehe auch Exkurs 07: "Der
Auferstehungsleib")
Christus wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit.
Phil 3,20 Denn unser Bürgerrecht ist in den
Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten,
3,21 der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit
seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag,
auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Phil 3,20-21;
Wie nun Johannes weiter oben, in Jh 20,3-8 berichtet, war zu dem
Zeitpunkt, als er und Petrus das leere Grab mit den Leinentüchern vorfanden,
auch Maria Magdalena mit ihnen. Erst als die beiden dann gegangen waren, wagte
auch sie einen Blick in die Gruft.
Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Jh 20,11 Maria aber stand draußen bei der Gruft
und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft 20,12
und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen
bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. 20,13 Und jene sagen zu ihr:
Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und
ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.
20,14 Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus
dastehen; und sie wußte nicht, daß es Jesus war. 20,15 Jesus spricht zu
ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der
Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn
hingelegt hast! Und ich werde ihn wegholen. 20,16 Jesus spricht zu ihr:
Maria! Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf hebräisch: Rabbuni! das heißt
Lehrer.
20,17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht
aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen:
Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott!
20,18 Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, daß sie den Herrn
gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Jh 20,11-18;
Maria Magdalena sah hier den Herrn, drei Tage nach seinem Tod,
unmittelbar nach seiner Auferweckung von den Toten. Und er hatte jenen "Leib
der Herrlichkeit" –
also den Geistleib –
, den Paulus weiter oben, in Phil
3,21 beschrieben hat. Darauf deutet auch die ausdrückliche Aufforderung des
Herrn an Maria Magdalena, dass sie ihn nicht berühren darf, weil er noch nicht
beim Vater im Himmel war.
Erst nachdem er nach seiner Auferweckung in den
Himmel zum Vater aufgefahren war, und dann, in seiner Auferstehung, mit
dem Auferstehungsleib wieder körperlich auf die Erde zurückkehrte um die
Jünger zu treffen, hatte er keinerlei Bedenken mehr sich von den Jüngern
berühren zu lassen. Im Gegenteil, er zeigte ihnen, dass sein Körper aus
Fleisch und Knochen bestand und er hat sogar Fisch gegessen und etwas getrunken,
um die Befürchtung der Jünger, er sei ein Geist, auszuräumen.
Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen.
Lk 24,36 Als sie aber davon redeten, trat er
selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! 24,37
Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist.
24,38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen
solche Gedanken in euer Herz?
24,39 Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fasst mich an
und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich
sie habe. 24,40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und
Füße.
24,41 Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach
er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 24,42 Und sie legten ihm ein Stück
gebratenen Fisch vor. 24,43 Und er nahm es und aß vor ihnen. Lk
24,36-43;
Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite.
Jh 20,26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger
abermals drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die
Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei
mit euch! 20,27 Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und
sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und
sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Jh 20,26-27;
(Siehe auch das Kapitel 12: "Die
Auferstehung")
Der tote Körper des Herrn lag also drei Tage im Grab, während
sein Geist im Totenreich war und dort den Geistern der Toten – also allen
Menschen, die seit Anbeginn der Welt gelebt haben und gestorben sind – das Evangelium verkündet hat.
Der Menschensohn war drei Tage und Nächte im Schoß der Erde.
Mt 12,38 Da fingen einige von den Schriftgelehrten
und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen
von dir sehen. 12,39 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und
abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen
gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. 12,40 Denn
wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der
Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Mt
12,38-40;
Er ist auch hinabgefahren in die Tiefen der Erde.
Eph 4,8 Darum heißt es (Psalm 68,19): »Er ist
aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen
Gaben gegeben.« 4,9 Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes,
als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? 4,10 Der
hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel,
damit er alles erfülle. Eph 4, 8-10;
Den Toten wurde das Evangelium verkündigt.
1Ptr 4,6 Denn dazu ist auch den Toten das
Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im
Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. 1Ptr 4, 6;
(Siehe auch Exkurs 09: "Das
Paradies.")
Wir haben hier nicht nur die dezidierte Aussage, dass der Herr
nach seinem Tod in die Tiefen der Erde, ins Totenreich hinabgefahren ist,
sondern auch die Erklärung dafür, was er in dieser Zeit im Totenreich getan
hat: Wie auch zu seinen Lebzeiten den Lebenden, hat er nun, als Toter, den Toten
im Totenreich, die vor seiner irdischen Existenz gestorben sind, das Evangelium
verkündigt und ihnen die Rettung aus Gnade angeboten.
Am dritten Tage ist er
dann aus dem Totenreich zurückgekehrt und der Geist des Lebens von Gott ist in
seinen Körper gekommen und er wurde auferweckt.
Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und wir haben mit ihm gegessen, nachdem er auferstanden war.
Apg 10,38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit
Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle
heilte, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 10,39 Und
wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in
Jerusalem getan hat; den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz
hängten. 10,40 Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt [egeiren]
und ihn sichtbar werden lassen, 10,41 nicht dem ganzen Volk, sondern
den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und
getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden [anastenai]
war. Apg 10,38-41;
(Siehe auch Kapitel 12: "Auferweckung
und Auferstehung.")
Wir haben für diesen Vorgang der Auferweckung auch ein sehr
guten Beispiel in der Offenbarung. Die zwei Zeugen Gottes, denen von Gott
Vollmacht gegeben wurde, 1260 Tage zu weissagen und während dieser Zeit den
Himmel zu verschließen und die Erde mit jeder Plage zu schlagen sooft sie nur
wollten, werden am Ende ihrer Zeit vom Tier aus dem Meer, dem dämonischen
Antichristen, getötet werden.
Und ihre Leichname werden auf den Straßen
Jerusalems liegen und die Menschen werden sich freuen, dass sie endlich diese
Propheten die sie quälten losgeworden sind und werden feiern und verhindern,
dass die Leichname begraben werden. Doch nach dreieinhalb Tagen geschieht
Folgendes:
Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie.
Off 11,11 Und nach den drei Tagen und einem
halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf
ihre Füße; und große Furcht befiel die, welche sie schauten. 11,12 Und sie
hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier herauf! Und
sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde.
Off 11,11-12;
Diese zwei Zeugen Gottes werden also nach dreieinhalb Tagen von
den Toten auferweckt (überkleidet) und in den Himmel entrückt. Das ist aber
nun genau jener Vorgang, welcher uns auch hier weiter oben von den Aposteln im
Zusammenhang mit der Auferweckung des Herrn berichtet wird.
Und eben dieser
Vorgang der Auferweckung, in dem der Geist des Lebens von Gott den Körper des
Herrn verwandelte (überkleidete), könnte nun die Ursache für den ansonsten
völlig unerklärbaren Abdruck des Körpers auf dem Turiner Grabtuch sein.
Leider wird aber die Wissenschaft diese Argumentation als unwissenschaftlich
zurückweisen und lieber weiterhin in Ungewissheit verharren. Obwohl man das
jetzt nur zur Kenntnis nehmen kann, weil eben Weltmenschen keinen Glauben und
schon gar keine Ahnung von der Bibel haben, ist das bei gläubigen
Christenmenschen etwas anders.
Wer als Christ derartige Möglichkeiten nicht in Betracht zieht und sie, wie im eingangs zitierten Beitrag auf der Website Bibelkreis.ch, a priori als "antichristlich" und "lästerlich" abqualifiziert, dokumentiert damit seine Oberflächlichkeit und seine Unkenntnis
der Schrift und man muss daher davon ausgehen, dass auch seine übrigen Glaubensinhalte nicht biblisch fundiert sind.
In Ihrem letzten Diskurs "Das Turiner Grabtuch"
ist es Ihnen dankenswerterweise gelungen, alle gegenwärtig relevanten
Fakten zu diesem Thema zusammenzufassen und mit den diesbezüglichen
biblischen Aussagen zusammenzuführen. Damit ist dieses Dokument
ausgesprochen hilfreich bei der Diskussion und der realistischen Beurteilung
dieses Problemkreises.
Was jedoch in Ihrer Arbeit leider nicht näher behandelt wird, ist die
Tatsache, dass Johannes in Jh 20,5-7 drei Mal von "Leinentüchern"
– also Plural – spricht und mit dem Turiner Grabtuch ja nur ein einziges
Leinentuch vorliegt. Auch weist der Evangelist in Jh 20,7 auf ein
Schweißtuch hin, das Jesus auf seinem Haupt hatte und welches zum Zeitpunkt
als Petrus und Johannes das Grab besuchten, zusammengewickelt an einem
besonderen Ort lag. Wenn also das Schweißtuch um den Kopf des Toten
gewickelt war, müsste bei der Auferstehung die Abbildung des Angesichts auf
dem Schweißtuch erfolgt sein und nicht auf dem Grabtuch.
W.Niemetz@gmx.de
Schönen Dank für diesen Hinweis, er ist durchaus berechtigt
und zeugt von außerordentlicher Aufmerksamkeit. Der Umstand, dass diese
Schriftaussagen im obigen Diskurs nicht zur Sprache kamen, ist wahrscheinlich
darauf zurückzuführen, dass es bisher meines Wissens keinen Ausleger gegeben
hat, der auf diese Details bei diesem speziellen Thema eingegangen wäre und sie
somit offensichtlich auch mir entgangen sind.
Allerdings ist anzumerken, dass nur Johannes diese Leinentücher erwähnt, während alle drei anderen
Evangelisten nur von einem Leinentuch sprechen, wie die nachfolgenden Texte
zeigen.
Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch.
Mt 27,57 Als es aber Abend geworden war, kam ein
reicher Mann von Arimathäa, mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger
Jesu war. 27,58 Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl
Pilatus, den Leib zu übergeben. 27,59 Und Josef nahm den Leib und wickelte
ihn in ein reines Leinentuch 27,60 und legte ihn in seine neue Gruft,
die er in den Felsen ausgehauen hatte; und er wälzte einen großen Stein
an die Tür der Gruft und ging weg. 27,61 Es waren aber dort Maria Magdalena
und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Mt 27,57-61;
Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leinentuch.
Mk 15,42 Und als es schon Abend geworden war – es
war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat – 15,43 kam Josef von Arimathäa,
ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete, und er
wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. 15,44 Pilatus aber
wunderte sich, daß er schon gestorben sein sollte; und er rief den Hauptmann
herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. 15,45 Und als er es von
dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. 15,46 Und der kaufte feines
Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leinentuch und legte
ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein
an die Tür der Gruft. 15,47 Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des
Joses, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Mk 15,42-47;
Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch.
Lk 23,50 Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der
ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann 23,51 – dieser hatte nicht
eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat – von Arimathäa, einer Stadt der
Juden, der das Reich Gottes erwartete; 23,52 dieser ging hin zu Pilatus und bat
um den Leib Jesu. 23,53 Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in
ein Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin
noch nie jemand gelegen hatte. 23,54 Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach
an. 23,55 Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen
waren, und besahen die Gruft, und wie sein Leib hineingelegt wurde. Lk 23,50-55;
Nun sind aber die Berichte der drei Synoptiker – im Unterschied
zum Johannesevangelium – keine direkten Augenzeugenberichte, sondern stützen
sich auf Aussagen von Zeitzeugen aus zweiter oder dritter Hand. Daher kommt dem
Evangelium des Johannes hier ein besonderer Stellenwert zu und man muss seine
Aussagen zu diesem Thema genau prüfen. Wir wollen daher versuchen, diesen Text
zu hinterfragen und sehen uns noch einmal die betreffende Schriftstelle an:
Simon Petrus sieht die Leinentücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, an einem besonderen Ort.
Jh 20,1 An dem ersten Wochentag aber kommt Maria
Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der
Gruft weggenommen. 20,2 Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem
anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn
aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
20,3 Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft.
20,4 Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus,
schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft; 20,5 und als er sich
vornüberbückt, sieht er die Leinentücher daliegen; doch ging er nicht
hinein. 20,6 Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in
die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen 20,7 und das
Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern
liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. 20,8 Da
ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah
und glaubte. 20,9 Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, daß er aus den
Toten auferstehen mußte. 20,10 Da gingen nun die Jünger wieder heim. Jh 20,
1-10;
Wenn Johannes hier von Leinentüchern –
also Plural – schreibt, kann das m. E. zwei Gründe haben. Es war bei Bestattungen im damaligen Israel durchaus nicht üblich den Toten in nur einem einzigen großen Leichentuch zu
bestatten. Derart große Tücher – das Turiner Grabtuch misst in der Länge 4,36
m und in der Breite 1,10 m – waren doch relativ kostspielig und eine
Durchschnittfamilie konnte oder wollte sich das wahrscheinlich nicht leisten.
Einen Beweis dafür finden wir in der Schrift bei der Auferweckung des Lazarus
durch den Herrn:
Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt.
Jh 11,41 Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber
hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, daß du mich erhört hast.
11,42 Ich aber wußte, daß du mich allezeit erhörst; doch um der Volksmenge
willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, daß du mich
gesandt hast. 11,43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme:
Lazarus, komm heraus! 11,44 Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und
Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem
Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und laßt ihn
gehen! Jh 11,41-44;
Lazarus war also mit (mehreren) Grabtüchern an Füßen und
Händen umwickelt. Das war die übliche und damals allgemein bekannte
Vorgangsweise bei mosaischen Bestattungen. Und als nun Johannes oben, in Jh
20,5, vornübergebückt in die Gruft hineinblickte ohne gleich hinein zu gehen,
sah er dort "Leinentücher" liegen.
Beide, Petrus und Johannes sind dann, als sie das leere Grab gesehen hatten, gleich wieder gegangen ohne sich die Tücher näher anzusehen. Der Grund für dieses Zögern beim Hineingehen und das
schnellen Verlassen des Grabes liegt in den strengen Vorschriften des mosaischen
Gesetzes, nach welchem das Berühren von Gegenständen eines Toten – ja selbst
das Betreten eines Grabes, in dem ein Toter liegt – den Gläubigen verunreinigt
und danach entsündigt werden muss.
Es ist daher durchaus plausibel, dass Johannes durch die oberflächliche Betrachtung von der Annahme ausging, es wären – wie üblich – mehrere Tücher auf einem Haufen gelegen obwohl es sich
tatsächlich nur um ein Tuch handelte das dort lag.
Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, dass es tatsächlich mehrere
Grabtücher gewesen sind. Es könnte der tote Körper in das lange Grabtuch der
Länge nach eingehüllt und dann darüber mit mehreren kleineren Tüchern in der
Breite umwickelt worden sein. Dies ist zwar unwahrscheinlich, wie wir gleich
weiter unten sehen werden, aber auch in diesem Fall müsste der Effekt der
Abbildung auf dem Grabtuch bei der Auferweckung derselbe gewesen sein, wie wenn
der Körper nur in das großes Leinentuch eingeschlagen gewesen wäre.
Wenn wir nun die Grablegung Christi mit der damals – und teilweise bis heute –
im Judentum gebotenen und gepflogenen Bestattung vergleichen, so ist zu
erkennen, dass es sich beim Tod des Herrn keinesfalls um eine gesetzeskonforme
rituelle Bestattung handelte. Der mosaische Ritus schreibt z. B. vor, dass der
Tote gewaschen wird und die sterbliche Hülle dann in Leinentücher gewickelt
wird. Wenn das Turiner Grabtuch echt ist, wurde beides unterlassen.
Die
mannigfachen Blutspuren auf dem Grabtuch lassen erkennen, dass der Tote nicht
gewaschen wurde und auch das bloße Einschlagen in ein Leinentuch anstelle des
Einwickelns wirft die Frage auf, warum Josef von Arimathäa dies alles
verabsäumt haben sollte. Um hier ein besseres Verständnis für die Situation
zu bekommen, müssen wir uns daher etwas näher mit der Person des Josef von
Arimathäa und den damaligen Begleitumständen auseinandersetzen.
Josef war aus Arimathäa, dem heutigen Rentis nordöstlich von Lydda, einer
Kleinstadt in der Nähe von Tel Aviv. Er war ein angesehener Ratsherr (Mk 15,43;
Lk 23,50) und somit Mitglied des Hohen Rates. Er war ein reicher Mann (Mt
27,57), der selbst auch das Reich Gottes erwartete (Mk 15,43) und er hatte dem
Urteil des Hohen Rates, Jesus von Nazareth an die Römer zur Kreuzigung
auszuliefern, nicht zugestimmt (Lk 23,51), weil er –
obwohl Mitglied des Hohen
Rates –
selbst auch ein Jünger Jesu war (Mt 27,57).
Der Tag der Kreuzigung war ein Rüsttag. Das ist der Tag vor einem jüdischen
Feiertag, also entweder vor dem wöchentlichen Sabbat, dann wäre es der
Freitag, oder wie in diesem Fall (Jh 19,31), vor dem jährlichen, dem "Großen
Sabbat" (Schabbat haGadol), der an keinen festen Wochentag, sondern an das
Datum (14. Nisan) gebunden war.
Eine weitere Besonderheit der jüdischen Tageseinteilung war der Beginn eines
24 Stunden-Tages nicht um Null Uhr, wie das heute üblich ist, sondern der
Tagesanfang war bei Sonnenuntergang. Die Stundenzählung begann daher um 18 Uhr
mit der Nacht (Vorabend), die dann zwölf Stunden bis sechs Uhr früh dauerte.
Und um sechs Uhr früh begann der Tag und währte 12 Stunden bis 18 Uhr abends.
Und so sind nun auch die Zeitangaben in den biblischen Berichten über
die Kreuzigung zu verstehen.
Der Tod Jesu am Kreuz.
Mk 15,24 Und sie kreuzigen ihn. Und sie verteilen
seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte.
15,25 Es war aber die dritte Stunde, und sie kreuzigten ihn. 15,26 Und
die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben: Der König der
Juden. 15,27 Und mit ihm kreuzigen sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und
einen zu seiner Linken. 15,28 (0) 15,29 Und die Vorübergehenden lästerten ihn,
schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha! Der du den Tempel abbrichst und in drei
Tagen aufbaust, 15,30 rette dich selbst, und steige herab vom Kreuz! 15,31
Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten untereinander
und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. 15,32
Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen
und glauben! Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. 15,33 Und in
der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten
Stunde; 15,34 und in der neunten Stunde schrie Jesus mit
lauter Stimme: Eloí, Eloí, lemá sabachtháni?
was übersetzt ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
15,35 Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie: Siehe, er ruft Elia.
15,36 Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr,
gab ihm zu trinken und sprach: Halt, laßt uns sehen, ob Elia kommt,
ihn herabzunehmen! 15,37 Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus
und verschied. Mk 15,24-37;
In der dritten Stunde dieses Tages – also um neun Uhr –
kreuzigten sie ihn und in der sechsten Stunde – um 12 Uhr Mittag – kam
eine Finsternis über das ganze Land und in der neunten Stunde – also
um 15 Uhr an diesem Tag – verschied der Herr am Kreuz. Josef von Arimathäa
hatte nun ein Felsengrab in Jerusalem in seinem Besitz, welches er für seine
eigene Bestattung gekauft hatte. Und er hatte sich entschlossen, den Herrn vom Kreuz
zu holen und ihn in dieses noch unbenützte Grab zu legen.
Doch damit begann jetzt für Josef von Arimathäa ein Wettlauf mit der Zeit.
Damit er den Herrn vom Kreuz nehmen durfte, musste er zuerst die Genehmigung von
Pilatus einholen. Dieser wieder ließ zuvor den Hauptmann kommen, welcher die
Soldaten auf der Schädelstätte (Golgatha) befehligte (Mt 27,54; Mk 15,44-45),
um ihn zu befragen ob denn der Nazarener tatsächlich schon tot sei. Als das
bestätigt wurde, schenkte Pilatus dem Josef den Leichnam. Josef hat dann in der
Stadt das Leinentuch und das Schweißtuch gekauft (Mk 15,46) und musste auch
noch Knechte aufnehmen, um den Toten vom Kreuz herabzunehmen und zum Felsengrab
zu transportieren.
Die Zeitnot, in welcher sich Josef befand, war auf den Umstand zurückzuführen,
dass um 18 Uhr der Große Sabbat begann, an dem die Juden keinerlei Arbeit
verrichten und schon gar keine Totenbestattung durchführen durften. Er hatte
also etwa drei Stunden Zeit, wovon der Gang in die Stadt zu Pilatus wegen der
Erlaubnis der Kreuzabnahme, die Beschaffung der Leinentücher, die Aufnahme von
Knechten und der Rückweg nach Golgatha sowie die Kreuzabnahme selbst und der
Transport, mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits den größten Teil dieser Zeit
in Anspruch genommen hatten, sodass für die Bestattung selbst nicht mehr viel
Zeit blieb.
Und nachdem das Berühren eines Toten nach dem mosaischen Gesetz
sieben Tage Unreinheit bedeutete (
4Mo
19,11.
14)
– also für die gesamte Zeit des Pessachfestes – konnte gerade Josef von
Arimathäa, als Ratsherr, den Körper selbst nicht berühren und musste daher
die eigentliche rituelle Bestattung durch jüdische Frauen und Männer auf den
Tag nach dem Sabbat verschieben.
Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein.
4Mo 19,11 Wer einen Toten berührt, die Leiche
irgendeines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein. 19,12 Dieser soll
sich am dritten Tag damit entsündigen, und am siebten Tag wird er rein sein;
und wenn er sich nicht entsündigt am dritten Tag, dann wird er am siebten Tag
nicht rein sein. 19,13 Jeder, der einen Toten berührt, die Leiche eines
Menschen, der gestorben ist, und sich nicht entsündigt, hat die Wohnung des
HERRN unrein gemacht; und diese Seele soll ausgerottet werden aus Israel.
Weil das Wasser der Reinigung nicht auf ihn gesprengt wurde, ist er unrein;
seine Unreinheit ist noch an ihm. 19,14 Dies ist das Gesetz, wenn ein Mensch in
einem Zelt stirbt: Jeder, der in das Zelt geht, und jeder, der in dem Zelt ist,
wird sieben Tage unrein sein. 19,15 Und jedes offene Gefäß, auf dem kein
festgebundener Deckel ist, wird unrein sein. – 19,16 Und jeder, der auf
freiem Feld einen mit dem Schwert Erschlagenen oder einen Verstorbenen oder die
Knochen eines Menschen oder ein Grab berührt, wird sieben Tage unrein sein.
4Mo 19,11-16;
Die Berichte in den Evangelien (z.B. Mt 27,59-60), dass Josef
von Arimathäa den Herrn selbst in Leinentücher wickelte, selbst in die Gruft
legte und selbst den schweren Stein an die Tür der Gruft wälzte, sind daher
als Verkürzung des Geschehens zu betrachten, wie wir das öfter in der Schrift
vorfinden.
Ebenso auch die Aussage in Mt 27,60, dass Josef die Gruft selbst in
den Felsen ausgehauen hätte oder die Angabe in Jh 19,41, dass diese Gruft in
einem Garten an der Kreuzigungsstätte gelegen wäre. Ein angesehenes und
reiches Mitglied des Hohen Rates, wie Josef von Arimathäa, wird sich sein Grab
nicht selbst aus dem Felsen hauen und wenn er es daher erworben hat, wird er es
nicht ausgerechnet an jenem Ort gekauft haben, an dem die römische
Besatzungsmacht die Hinrichtung von Verbrechern durchführen ließ.
Daher wird auch der Transport von Golgatha zum eben doch weiter entfernt liegenden
Felsengrab den noch verbliebenen Teil der drei Stunden in Anspruch genommen haben.
Und das alles scheint nun der Grund dafür gewesen zu sein, warum Josef von
Arimathäa das Waschen, Einbalsamieren und rituskonforme Einwickeln in das
Grabtuch aus Zeitmangel vorerst zurückgestellt hatte und den Leichnam Jesu in
aller Eile in das Grab bringen ließ, mit der Absicht, dies alles am
übernächsten Tag nachzuholen.
Und deshalb finden wir auch im Grabtuch jede Menge Blutspuren, weil der Körper
nicht gewaschen wurde, kein Zeichen einer Einbalsamierung, sondern nur lose Aloe und Myrrhe,
wahrscheinlich um den zu erwartenden Geruch des Leichnams bei den Bestattungsarbeiten
am übernächsten Tag zu lindern. Und schließlich eben den Körper
in ein großes Leinentuch bloß eingeschlagen anstatt eingewickelt.
Die Einzigen, welche dem Josef von Arimathäa vom Kreuz zum Grab gefolgt sind
und daher Augenzeugen der Grablegung waren, waren jene Frauen (Mt 27,61; Mk
15,47; Lk 23,55), welche auch bei der Kreuzigung schon am Kreuz gestanden hatten
(Lk 23,49; Jh 19,25-26). Wir finden bei den Synoptikern keine Erwähnung
darüber, dass die Jünger am Kreuz oder bei der Grablegung dabei gewesen
wären. Im Gegenteil, wie wir in Mt 26,56 lesen, hatten alle Jünger den Herrn
bei seiner Verhaftung im Garten Gethsemane verlassen und sind geflohen.
Nur Johannes berichtet, dass er mit der Mutter Jesu und den anderen Frauen am
Kreuz gestanden habe, aber er schreibt nichts davon, dass er selbst auch an der
Grablegung teilgenommen hätte. Daher muss man davon ausgehen, dass auch er
nicht wusste, wie das Leichentuch ausgesehen hatte, mit dem Josef den Leichnam
Jesu bedecken ließ und deshalb spricht Johannes auch unspezifisch von
"Leinentüchern", welche er nach der Auferweckung im leeren Grab
liegen gesehen hatte.
Im Gegensatz dazu hatten die Informationen der Synoptiker offensichtlich ihren
Ursprung in den Aussagen der Frauen, welche an der Grablegung teilgenommen und
gesehen hatten, dass der Leichnam des Herrn in einem einzigen großen Leinentuch
eingehüllt wurde.
(Siehe auch Diskurs 40: "Gibt
es Fehler in der Bibel?")
Schließlich gehen auch andere Aussagen im Rahmen dieses Themas
im Johannesevangelium nicht mit den Texten der Synoptiker konform. So spricht
Johannes davon, dass Josef von Arimathäa gemeinsam mit Nikodemus den Leichnam
eingewickelt hätte. Nikodemus wird bei den Synoptikern in diesem Zusammenhang
überhaupt nicht erwähnt. Auch schreibt Johannes, dass diese beiden den
Leichnam mit "ungefähr hundert Litra" (Litra = antikes grie. Gewicht = ca.
1 Pfund / 1/2 kg) – also ca. 33 kg – einer Mischung von Myrrhe und Aloe
einbalsamiert hätten.
Sie wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist.
Jh 19,39 Es kam aber auch Nikodemus, der
zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und
Aloe, ungefähr hundert Pfund. 19,40 Sie nahmen nun den Leib Jesu und
wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den
Juden zu bestatten Sitte ist. Jh 19,39-40;
Bei den Synoptikern lesen wir hingegen, dass es die Frauen
waren, die nach ihrer Rückkehr in ihre Häuser wohlriechende Öle und Salben
bereitet hatten (Lk 23,56) und am ersten Wochentag (Sonntag morgens), sehr
früh, als die Sonne aufgegangen war, zu der Gruft gegangen sind und den
Leichnam einbalsamieren wollten. Zu dieser Zeit fanden sie aber das Grab bereits
leer vor (Mk 16,2-6; Lk 24,1-3).
Doch auch wenn diese Frauen den Herrn nicht mehr salben konnten, wurde dennoch
die rituelle Salbung mit wohlriechenden Ölen, wie es bei einer jüdischen
Bestattung Sitte war, an ihm vorgenommen. Zwei Tage (Mt 26,2; Lk 22,1-2) vor
seiner Kreuzigung war der Herr in Betanien im Hause Simons, des Aussätzigen und
lag dort zu Tisch. Und hier kam eine Frau zu ihm und goss ein
Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl über sein Haupt.
Als sie dieses Salböl über meinen Leib goß, tat sie es zu meinem Begräbnis.
Mt 26,6 Als aber Jesus in Betanien war, im Hause
Simons, des Aussätzigen, 26,7 kam eine Frau zu ihm, die ein
Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte, und goß es aus auf sein
Haupt, als er zu Tisch lag. 26,8 Als aber die Jünger es sahen, wurden sie
unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? 26,9 Denn dies hätte teuer
verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. 26,10 Als aber Jesus
es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein
gutes Werk an mir getan; 26,11 denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich
aber habt ihr nicht allezeit. 26,12 Denn als sie dieses Salböl über meinen
Leib goß, tat sie es zu meinem Begräbnis. Mt 26, 6-12;
Wie uns Johannes in der Parallelstelle, in Jh 12,1-8
überliefert, war es Maria aus Betanien, die Schwester der Marta und des
Lazarus, der vom Herrn von den Toten auferweckt wurde, welche hier den Herrn
salbte und ohne dass sie es wusste, die Salbung für seine Bestattung am
übernächsten Tag vorwegnahm.
Hinsichtlich des Schweißtuches, welches Johannes erwähnt, muss
man nun der Argumentation in der obigen Replik von W. Niemetz vollkommen
zustimmen. Wenn das Haupt des Herrn tatsächlich mit dem Schweißtuch umwickelt
gewesen wäre, hätte bei der Auferweckung, durch die Umwandlung des toten
physischen Körpers in einen Geistleib, die Abbildung auf dem Schweißtuch und
nicht auf dem Grabtuch erfolgen müssen.
Nun muss man aber auch hier – wie oben bei den "Leinentüchern"
– berücksichtigen, dass Johannes an der Grablegung nicht teilgenommen hatte
(Jh 19,38-42) und daher nicht wissen konnte, ob das Haupt Jesu mit dem Schweißtuch
eingewickelt wurde oder nicht. Und ebenso wie er möglicherweise das Leinentuch
in der Eile für mehrere Tücher hielt, weil das nun mal so der Gepflogenheit
entsprach, könnte er auch hier automatisch davon ausgegangen sein, wenn dort
ein Schweißtuch lag, dass es der Herr um das Haupt gewickelt gehabt hatte.
Aber gerade dies ist aufgrund der obigen Situationsanalyse doch sehr fraglich.
Wie wir gesehen haben, hatte Josef von Arimathäa, als er mit dem Leichnam vor
dem Felsengrab einlangte, gerade noch Zeit, den toten Körper in das Leinentuch
zu hüllen und in die Gruft legen zu lassen. Das Einwickeln des Hauptes war
jedoch eine Arbeit, welche, ordnungsgemäß verrichtet – wozu das Haupt
natürlich auch gewaschen werde musste – , ihre Zeit benötigte, die Josef zu
diesem Zeitpunkt aber nicht mehr hatte.
Auch konnten wir oben aus den in der Schrift verfügbaren Hinweisen erkennen,
dass sich Josef offensichtlich aufgrund des Zeitmangels entschlossen hatte, die
rituskonforme Bestattung mit Waschung, Einbalsamierung und Einwickeln mit dem
Grabtuch und dem Schweißtuch, erst nach dem Sabbat durchzuführen und den
Leichnam vorerst nur einmal provisorisch zu bedecken und in der Gruft zu
deponieren.
Und das war möglicherweise auch mit den Frauen abgesprochen, welche
an dieser provisorischen Grablegung teilgenommen und gesehen hatten wie der Leib
des Herrn hineingelegt wurde (Lk 23,55). Deshalb haben sie dann zuhause "wohlriechende
Öle und Salben" bereitet und sind nach dem Sabbat, am ersten Wochentag sehr
früh zur Gruft gegangen und wollten den Leichnam einbalsamieren (Mk 16,1).
Daraus ist nun abzuleiten, dass das Haupt des Herrn nicht mit dem Schweißtuch
umwickelt war, sondern nur das Grabtuch den gesamten toten Körper darüber und
darunter bedeckte. Und daher erscheint das, durch die Strahlung bei der
Umwandlung des physischen Körpers in einen Geistleib verursachte Abbild des
Gesichts ebenso auf dem Grabtuch wie das des gesamten Körpers.

Lage des Leichnams im Tuch.
(aus https://www.huinfo.at/grabtuch/grabtuch.html)
Doch wenn das Schweißtuch nicht verwendet wurde, stellt sich
schließlich doch die Frage, wieso Johannes dieses ganz eindeutig und
unzweifelhaft identifiziert hat, als er in die Gruft hineinblickte? Wenn wir den
gesamten Text im Zusammenhang betrachten, erkennen wir den Hintergrund:
Und sieht das Schweißtuch nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort.
Jh 20,6 Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und
ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen 20,7 und das
Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern
liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Jh 20,
6- 7;
Wie viele Ausleger sich hier wohl schon gefragt haben mögen,
warum der Herr nach seiner Auferweckung das Grabtuch unbeachtet liegen ließ,
während er das Schweißtuch fein säuberlich zusammengewickelt und an einem
besonderen Ort aufbewahrt hatte. Im Lichte der obigen Analyse ist die Antwort
aber ganz einfach: Es war nicht der Herr, der das Schweißtuch nach seiner
Auferweckung beiseite gelegt hat. Es war Josef von Arimathäa, der zuvor das
Schweißtuch und das Grabtuch in der Stadt gekauft und mitgebracht hatte und
nachdem die Zeit für eine rituskonforme Bestattung nicht reichte, den Körper
in das Grabtuch provisorisch eingehüllt und das unbenutzte Schweißtuch für
die richtige Bestattung am übernächsten Tag separiert bereitgelegt hat.
Jesus lag im Grab längstens von Freitag, ca. 17 Uhr bis
Sonntag, sehr führ morgens. Wenn wir spätestens ca. 7 Uhr annehmen, haben
wir zwar künstlich drei Tage erreicht: die letzte Stunde des Freitags, der
ganze Samstag und die erste Stunde des Sonntags. Drei Nächte sind aber
nicht unterzubringen. ist also Freitag der Kreuzigungstag? (...)
An einer Ungenauigkeit der Schrift an spez. dieser Stelle von Mt. 12,40,
möchte ich nicht festhalten; nicht zuletzt weil es Worte des Herrn sind.
Gerade Immanuel.at betont wiederholte Male, dass solche Vorrang haben, wenn
die Kompatibilität mit anderen Bibelversen gesucht wird.
Zu Beginn meines Glaubens war mir David Pawson eine große Verständnishilfe
für Gottes Wort. Es liegt mehrere Jahre zurück, da hatte ich seine
Auslegung zum betreffenden Thema gelesen oder gehört. In Kürze geht es
darum, dass ein weiterer Tag zwischen dem Rüsttag und dem ersten Wochentag
an diesem großen Sabbat lag. Ich habe seine Auslegung im Detail vergessen,
sie daher wieder angefordert und werde mir erlauben Ihnen diese
nachzureichen.
Giuseppe De Candia
(Das von G. De Candia in seiner obigen Replik zitierte Buch von
David Pawson trägt den Titel "Der Weg zur Hölle" [The Road to Hell] und
ist in deutscher Übersetzung in der Librarie Chrétienne CARREFOUR erschienen.
ISBN 2 88272-023 8). Ich bedanke mich bei Bruder De Candia für die Überlassung
dieser ausgezeichneten Arbeit.
(Siehe auch Diskurs 88: "David
Pawson und die Interpretation der endzeitlichen Abläufe.")
Danke für den Hinweis! Dies ist tatsächlich eine Frage, mit
welcher sich die Exegese immer wieder beschäftigt ohne bisher eine eindeutige
Antwort gefunden zu haben. Wir haben die Aussage des Herrn in Mt 12,40:
Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein.
Mt 12,38 Dann antworteten ihm einige der
Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen
von dir sehen! 12,39 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und
ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm
gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. 12,40 Denn wie Jona
drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der
Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. 12,41
Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden
es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas; und siehe, mehr als
Jona ist hier. Mt 12,38-41;
Es ist dies die ganz klare und unmissverständliche Aussage, die
noch dazu vom Herrn selbst geäußert wird, dass er drei Tage und drei Nächte
im Herzen der Erde sein wird. Wie nun aber Bruder De Candia in seiner obigen
Replik völlig richtig anmerkt, erstreckt sich die konventionelle Interpretation
nur vom Tod des Herrn am Kreuz, am Rüsttag (Tag vor dem Sabbat, der in der
landläufigen Auslegung als der Freitag gedeutet wird) in der neunten Stunde
(also um 15 Uhr unserer Zeit), bis zum Sonntagmorgen (etwa um 6-7 Uhr), als die
Frauen das leere Grab vorfanden.
Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war.
Mk 16,1 Und als der Sabbat vergangen war,
kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome
wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 16,2 Und sie kommen
sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war.
16,3 Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft
wegwälzen? 16,4 Und als sie aufblickten, sehen sie, daß der Stein
zurückgewälzt ist; er war nämlich sehr groß. Mk 16, 1- 4;
Und das sind aber nur zwei Nächte und wenn man die jüdische
Tageseinteilung berücksichtig, nur nominell drei Tage: und zwar am Tag der
Kreuzigung 3 Stunden, nämlich von 15 Uhr bis 18 Uhr (da endete der Rüsttag und
begann der Sabbat), den ganzen Sabbat bis 18 Uhr (da endete der Sabbat und
begann der erste Tag der Woche), bis zur Morgendämmerung als die Frauen kamen,
um den Leichnam zu salben und das Grab leer vorfanden.
Diese Ungenauigkeit hat
man bisher dadurch erklärt, dass es viele Aussagen des Herrn gibt, in welchen
er prophezeit, dass er "am dritten Tag" auferweckt werden wird. Und wenn es
auch nicht drei 24 Stunden-Tage waren, so waren es doch nach jüdischer
Zeitrechnung drei Tage.
Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, daß er am dritten Tag auferweckt werden müsse.
Mt 16,21 Von der Zeit an begann Jesus seinen
Jüngern zu zeigen, daß er nach Jerusalem hingehen müsse und von den
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und
am dritten Tag auferweckt werden müsse. Mt 16,21;
(Siehe auch Mt 20,19; Lk 9,22; 13,32; 18,33; 24,7.46;)
Doch hier erkennen wir gleich das nächste Auslegungsproblem:
Während Markus weiter oben, in Mk 16,1 schreibt, dass die Frauen die
wohlriechenden Öle nach dem Sabbat kauften, berichtet Lukas hier unten,
dass die Frauen die wohlriechenden Öle nach ihrer Rückkehr von der Grablegung
durch Josef von Arimathäa spät am Rüsttag – also vor dem Sabbat
– noch bereiteten und dann am Sabbat nach dem Gebot ruhten.
Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben; und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot.
Lk 23,54 Und es war Rüsttag, und der Sabbat
brach an. 23,55 Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa
gekommen waren, und besahen die Gruft, und wie sein Leib hineingelegt wurde.
23,56 Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle
und Salben; und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. Lk 23,54-56;
Gerade diese unterschiedlichen Angaben sind aber deshalb sehr
wichtig, weil sie einen ersten Anhaltspunkt für eine Lösung bieten:
es hat fast den Anschein, als ob Markus und Lukas von zwei verschiedenen Sabbatten
sprechen würden. Wir haben weiter oben festgestellt, dass diese Frauen der
Grablegung durch Josef von Arimathäa bis zum Schluss – also kurz vor
18 Uhr am Rüsttag und damit am Beginn des Sabbats – beigewohnt hatten.
Wenn nun aber Lukas in Lk 23,56 schreibt, dass sie die wohlriechenden Öle
bereitet hatten (bei Markus: "gekauft hatten"), als sie
zurückgekehrt waren, müsste um 18 Uhr bereits der Sabbat angebrochen
gewesen sein an welchem eine derartige Tätigkeit verboten gewesen wäre.
Es hat also auch hier den Anschein, dass Lukas von zwei verschiedenen Sabbatten
spricht: einmal der Sabbat nach dem Rüsttag, an dem der Herr gekreuzigt wurde
und dann von einem zweiten Sabbat, der durch seinen eigenen Rüsttag von dem
vorhergehenden Sabbat getrennt war, an welchem die Frauen die Öle
bereiten/kaufen konnten. Am zweiten Sabbat ruhten sie dann nach dem Gebot und am
ersten Tag der Woche, sehr früh, gingen sie zur Gruft.
Und wie wir später sehen werden, wäre das auch durchaus plausibel.
Jener Zeitpunkt, an dem die Frau(en) wieder zur Gruft gingen, scheint in allen
Evangelien identisch zu sein. Markus nennt weiter oben in Mk 16,2 "sehr früh,
am ersten Wochentag" und Lukas hier unten "An dem ersten Wochentag aber,
ganz in der Frühe".
An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft.
Lk 24,1 An dem ersten Wochentag aber, ganz in
der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die
sie bereitet hatten. 24,2 Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt;
24,3 und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Lk 24,
1- 3;
Auch Johannes spricht vom ersten Wochentag, wenngleich bei ihm
nur Maria Magdalena zur Gruft geht. Matthäus (nach Luther, King James und Darby)
bestätigt zwar wieder, dass es (mehrere) Frauen waren welche zur Gruft gingen,
nämlich jene, die bei der Grablegung durch Josef von Arimathäa dabei gewesen
waren, nennt aber als Zeitpunkt "spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten
Wochentages".
Dies würde bedeuten, dass die Frauen bereits spät am Sabbat
(Samstag abends gegen 18 Uhr) zur Gruft gingen und zu diesem Zeitpunkt die Gruft
bereits leer war.
An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft.
Jh 20,1 An dem ersten Wochentag aber kommt Maria
Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von
der Gruft weggenommen. 20,2 Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem
anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn
aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Jh
20, 1- 2;
Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen.
Mt 28,1 Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung
des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu
besehen. 28,2 Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben; denn ein Engel des
Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte
sich darauf. Mt 28, 1- 2;
Anhand dieser Angaben können wir also mit einer gewissen
Sicherheit die Auferweckung des Herrn noch vor dem Eintreffen der Frauen –
sehr
früh am ersten Wochentag, als es noch finster war – festlegen.
Nachdem dieser erste Wochentag am Samstag um 18 Uhr unserer Zeitrechnung begonnen hat,
kann daher die Auferweckung auch schon in den Abendstunden des Samstags erfolgt sein,
wie oben Mt 28,1 "Aber spät am Sabbat" nahe legt.
Interessant ist auch, dass in Mt 28,1 Sabbat im griechischen Text im Plural steht,
also "…nach den Sabbatten [sabbatwn]",
womit wir wieder einen Hinwies auf zwei Sabbatte in dieser Woche hätten.
Aber wie sieht es mit dem Todestag aus? Aufgrund der Aussage des Herrn, dass er
drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein wird, muss sein Einzug ins
Totenreich genau drei Tage und drei Nächte vorher erfolgt sein. Abhängig
davon, ob nun die Todesstunde oder die Grablegung den Beginn dieser drei Tage
darstellen, wäre dies die Zeit am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 18 Uhr.
Dafür würde auch die Fortsetzung des obigen Textes bei Matthäus sprechen,
in dem die Frauen schon spät am Sabbat zur Gruft kamen und der Herr schon auferweckt
war:
Geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, daß er von den Toten auferstanden ist!
Mt 28,2 Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben;
denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein
weg und setzte sich darauf. 28,3 Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein
Kleid weiß wie Schnee. 28,4 Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und
wurden wie Tote. 28,5 Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet
euch nicht! Denn ich weiß, daß ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 28,6 Er
ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die
Stätte, wo er gelegen hat, 28,7 und geht schnell hin und sagt seinen
Jüngern, daß er von den Toten auferstanden ist! Und siehe, er geht vor
euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch
gesagt. Mt 28, 2- 7;
Nun muss man darauf hinweisen, dass damals das Pessach-Fest –
der große Sabbat – vor der Tür stand und weil die Hohenpriester
eine von ihnenbeauftragte Kreuzigung direkt zu Pessach unbedingt vermeiden wollten,
wurde dieKreuzigung Jesu einen Tag vor dem Pessach-Fest – dem Rüsttag zu
Pessach – festgelegt.
Nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entstehe.
Mt 26,3 Dann versammelten sich die Hohenpriester
und die Ältesten des Volkes in dem Hof des Hohenpriesters, der Kaiphas hieß,
26,4 und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten.
26,5 Sie sagten aber: Nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem
Volk entstehe. Mt 26, 3- 5;
Zum besseren Verständnis soll hier der Ursprung dieses
Pessach-Festes kurz erläutert werden. Es geht zurück auf den Auszug Israels
aus Ägypten. Als der Pharao die Israeliten nicht aus Ägypten ziehen lassen
wollte, verhieß Gott um Mitternacht alle männliche Erstgeburt in Ägypten
sterben zu lassen. Vom Erstgeborenen des Pharao bis hin zum Erstgeborenen der
letzten Sklavin und aller Erstgeburt des Viehs.
Den Israeliten aber gebot der Herr, an diesem Tag – es war der 14. Tag des
ersten Monats (Nisan) – ein Einjähriges, Männliches ohne Fehler von den
Schafen oder von den Ziegen "zwischen den zwei Abenden" zu schlachten. Nach
der jüdischen Tageseinteilung, an der ein Tag um 18 Uhr beginnt, ist
damit die Zeit vom Sonnenuntergang (18 Uhr) bis zum völligen Eintritt der Nacht
(erster Abend oder Vorabend) und dem zweiten Abend, tags darauf, vom Niedergang
der Sonne (15 Uhr) bis zum Sonnenuntergang um 18 Uhr gemeint.
Mit dem Blut des geschlachteten Lammes sollten sie dann die beiden Türpfosten und die
Oberschwelle bestreichen, damit der Engel des Herrn diese Häuser erkenne und
sie von der Plage ausnimmt. Das Fleisch aber sollten sie noch in der selben
Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuerte Brote (Mazzes) und bittere
Kräuter.
Und ihr sollt es am vierzehnten Tag dieses Monats schlachten und mit dem Blut die Türpfosten bestreichen.
2Mo 12,5 Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches,
einjähriges, soll es für euch sein; von den Schafen oder von den Ziegen sollt
ihr es nehmen. 12,6 Und ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats
aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den
zwei Abenden schlachten. 12,7 Und sie sollen von dem Blut nehmen und es
an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in
denen sie es essen. 12,8 Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht
essen, am Feuer gebraten, und dazu ungesäuertes Brot; mit bitteren Kräutern
sollen sie es essen. 2Mo 12, 5- 8;
Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid.
2Mo 12,12 Und ich werde in dieser Nacht durch das
Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen vom Menschen
bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht
vollstrecken, ich, der HERR. 12,13 Aber das Blut soll für euch zum Zeichen
an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann
werde ich an euch vorübergehen: so wird keine Plage, die Verderben bringt,
unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. 2Mo 12,12-13;
Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats, am Abend.
2Mo 12,17 So haltet denn das Fest der ungesäuerten
Brote! Denn an eben diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten
herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für all
eure Generationen. 12,18 Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, am
Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats, am Abend.
2Mo 12,17-18;
Ab diesem Tag sollten die Israeliten dann sieben Tage lang nur
ungesäuerte Brote essen. Das war das Fest der ungesäuerten Brote (Pessach) zur
Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, welches mit der Schlachtung eines
männlichen Lammes in den Abendstunden des ersten Tages (Rüsttag), am 14. Nisan
begann und dann weitere sieben Tage, bis zum 21. dieses Monats währte.
Es sieht also so aus, als ob in dieser bestimmten Woche der
Kreuzigung Jesu in Israel 2 Sabbatte gefeiert wurden. Der erste, "große"
Sabbat war der des jährlichen Pessachfestes, das am 14. Nisan, einem Mittwoch,
mit dem Rüsttag begann. Der zweite Sabbat war dann der normale wöchentliche
Sabbat, also der Samstag, dessen Rüsttag der Freitag war.
Und damit lösen sich auch alle oben erwähnten Auslegungsprobleme:
der Herr war genau drei Tage und Nächte in der Gruft, die Frauen hatten zwischen
den beiden Sabbatten einen Tag, um die wohlriechenden Öle zu kaufen und zu bereiten.
Und auch der Plural im griechischen Text von Mt 28,1 hat seine volle Berechtigung,
wurde allerdings bisher von der Übersetzern – mangels besserem
Verständnis – ignoriert.
Bei der Recherche zu diesem Thema war mir u.a. das Buch "Das Zeichen des Jona"
von Dr. Werner Papke eine große Hilfe, nicht zuletzt, weil es sich in weiten
Bereichen mit meinen eigenen Erkenntnissen deckt. Er hat in seiner Arbeit
speziell auch die Datumsproblematik des jüdischen Kalenders akribisch
untersucht und konnte sogar den Tag der Kreuzigung Jesu genau datieren. Allen an
diesem Thema interessierten Lesern ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Hier
nachstehend nun eine kurze Zusammenfassung seiner Forschungsergebnisse:
Am 14. Nisan, einem Mittwoch
hatte Josef von Arimathäa den Leib Jesu ins Felsengrab gelegt. Er wälzte
einen Stein vor die Gruft und ging dann gegen 18 Uhr, kurz vor
Sonnenuntergang, davon.
Als die Sonne unterging begann der 15. Nisan, der große
Sabbat brach an, der bei Sonnenuntergang am Donnerstag
endete.
Am 16. Nisan, im Laufe des Freitags, kauften die
Frauen die Öle und Salben und bereiteten sie.
Bei Sonnenuntergang an diesem Freitag brach der wöchentliche Sabbat,
der 17. Nisan an. Bis zum Ende des Sabbat, am
Samstagabend,
ruhten die Frauen.
Noch am 17. Nisan, am Samstagabend, kurz vor
Sonnenuntergang am Ende des Sabbat, stand Jesus aus dem Grab
auf.
Bei Sonnenuntergang am Samstagabend brach der 18. Nisan
an, der bis zum Sonntagabend dauerte.
Am Sonntagmorgen, am 18. Nisan, machten sich die
Frauen "ganz in der Frühe" auf, um den Leib Jesu zu salben. Kurz vorher
hatte ein Engel den Stein von der Gruft gewälzt. Das Grab war leer.
Damit ist die herrschende Karfreitag-Ostersonntagmorgen-Tradition widerlegt:
Jesu wurde am Abend des 14. Nisan am Mittwoch-Abend,
begraben und stand am Abend des 17. Nissan, am Samstag-Abend,
aus dem Grabe auf.
(Auszug aus dem Buch "Das Zeichen des Jona – Wie lange war Jesus im Grab?"
S 42f, von Dr. Werner Papke)
www.dr-papke.de
| Tag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
| Zeit | 06 18 | 06 18 | 06 18 | 06 18 | 06 18 | 06 18 | 06 |
| 13. Nisan | 14. Nisan | 15. Nisan | 16. Nisan | 17. Nisan | 18. Nisan | 19. Nisan |
| Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag |
Rüsttag zu Pessach ab 18 Uhr Abendmahlfeier Festnahme in Gethsemane Kreuzigung 15 Uhr Tod am Kreuz ~ 18 Uhr Grablegung |
Beginn Pessach Großer jährlicher Sabbat |
Rüsttag Sabbat Kauf des Öls und der Salben |
Wöchentlicher Sabbat ~ 18 Uhr Auferweckung |
Erster Wochentag Frauen kommen zur leeren Gruft |
(Tag:
Nach der jüdischen Tageseinteilung beginnt der Tag um 18 Uhr und
endet am nächsten Tag um 18 Uhr.)
Obwohl nun die Daten und Fakten in Bezug auf den Tod des Herrn,
seine Grablegung und Auferweckung analysiert und behandelt wurden, bleibt ein
Bereich – der wichtigste – noch zu erwähnen: die Symbolik des
Geschehens.
Wie wir weiter oben, bei der Erklärung des Pessahfestes, anhand der
Schriftstellen aus dem Alten Testament (2Mo 12,5-18) gesehen haben, hat
Gott den Israeliten in Ägypten geboten, am 14. Nisan ein Lamm zu schlachten und
mit dessen Blut die beiden Türpfosten und die Oberschwelle ihrer Häuser zu
bestreichen. So sollten diese Häuser kenntlich sein und von den Plagen
verschont bleiben, mit welchen Gott die Ägypter bestrafen wollte, weil sie die
Israeliten nicht aus dem Land ziehen lassen wollten.
Aber Gott hat nicht nur ein Datum festgelegt, er hat auch eine ganz bestimmte
Zeit für die Schlachtung befohlen. In 2Mo 12,6 heißt es:
2Mo 12,6 Und ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag
dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde
Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. 2Mo 12, 6;
Die Schlachtung dieses Lammes sollte also am 14. Nisan zwischen
den zwei Abenden durchgeführt werden. Wie bereits oben erwähnt, ist mit der
Bezeichnung "zwischen den zwei Abenden" die Zeit vom Sonnenuntergang (18
Uhr) bis zum völligen Eintritt der Nacht (erster Abend) und tags darauf vom
Niedergang der Sonne um 15 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18 Uhr gemeint.
Und hier erkennen wir nun den Zusammenhang zwischen diesem Geschehen damals in
Ägypten und dem Tod des Herrn in Jerusalem. Ebenso wie damals das Blut des
geschlachteten Lammes die Israeliten vor dem Zorn Gottes bewahrt hat, ist Jesus
Christus, als das Lamm Gottes, für uns geschlachtet worden, damit auch wir
gerettet werden und der Zorn Gottes uns durch das Blut Christi verschont.
Und
dies ist exakt an jenem Tag – nämlich am 14. Nisan – geschehen,
an dem auch das Pessach Lamm geschlachtet wurde. Ja sogar die Zeit war identisch:
bis 15 Uhr sollten die Israeliten ihr Lamm schlachten und um 15 Uhr (in der
neunten Stunde) ist der Herr am Kreuz verschieden.
Doch ebenso wie damals nur jene Israeliten verschont blieben, welche
tatsächlich das Blut an ihre Türpfosten gestrichen hatten, werden auch seit
dem Tod des Herrn am Kreuz nur jene Menschen gerettet werden, welche an Christus
glauben und dieses Loskaufopfer für ihre Sünden bewusst annehmen.
Das muss man in der heutigen Zeit, wo verantwortungslose Prediger das Evangelium
verfälschen und die Menschen verführen, indem sie ihnen predigen, dass
Christus bedingungslos alle Menschen durch seinen Tod gerettet habe, ausdrücklich
erwähnen. Der Sohn Gottes ist wohl für alle Menschen gestorben, aber nicht
alle Menschen wollen dieses Opfer annehmen. Es liegt also am Menschen selbst, ob
er gerettet wird oder – ähnlich wie die Ägypter der damaligen Zeit
– dem ZornGottes anheimfällt.
(...) Ihre Auslegungen der Abläufe beim Tod Jesu
Christi (Diskurs 87 – das Turiner Grabtuch Anm. FH) sind
wirklich sehr aufschlussreich und haben bei mir einige Verständnislücken
gefüllt. Ein letztes Problem sehe ich aber noch, welches auch Sie nicht
behandelt haben. Wir haben in den synoptischen Evangelien die Berichte über
das letzte Abendmahl, bei dem von Jesus und den Aposteln das Passa gefeiert
und das Lamm gegessen wurde.
Sie schreiben nun, dass Jesus genau zu der Zeit getötet wurde (Lamm
Gottes), an der die Juden das Passalamm schlachteten und das Passa feierten.
Wie man in den Evangelien aber nachlesen kann, wurde Jesus erst am Tag nach
dieser Abendmahlfeier verurteilt und gekreuzigt. Es liegt also zwischen
Abendmahlfeier mit den Aposteln und dem Tod am Kreuz ein ganzer Tag
dazwischen.
Walter.Neumeier@chello.at
Vielen Dank für diesen Hinweis! Ihre Kritik ist durchaus
berechtigt. Ich habe diesen Punkt nicht ausführlich genug erklärt. Vor allem
habe ich die Problematik zwischen jüdischem und christlichem Kalender gerade in
Bezug auf diesen Zusammenhang missverständlich dargestellt. Der Text in 2Mo
12,6 lautet:
2Mo 12,6 Und ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag
dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde
Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. 2Mo 12, 6;
Für uns, die wir gewohnt sind mit dem christlichen Kalender zu
leben, entsteht hier der ganz selbstverständliche Eindruck, dass es sich bei
diesen "zwei Abenden" um den Abend dieses und den des nächsten Tages
handelt.
Tatsächlich ist es aber nicht so. Diese zwei Abende bezogen sich nach unserem
Kalender zwar auf zwei Tage, nach hebräischer Datierung jedoch auf einen
einzigen Tag, nämlich den 14. Nisan. Das hängt damit zusammen, dass
– wie bereits weiter oben ausgeführt – der jüdische Tag um
18 Uhr unserer Zeit beginnt und um 18 Uhr unseres nächsten Tages endet.
Es gibt daher an jedem jüdischen Tag zwei Abende: einen zu Beginn des Tages
(ab 18 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit) und einen zweiten am Ende (bei uns: des
darauffolgenden Tages) von 15 Uhr (Niedergang der Sonne) bis 18 Uhr. Dies ist auch
ganz deutlich aus 3Mo 23,32 zu entnehmen:
Am Neunten des Monats, am Abend, vom Abend bis zum Abend, sollt ihr euren Sabbat feiern.
3Mo 23,32 Ein ganz feierlicher Sabbat soll er für
euch sein, und ihr sollt euch selbst demütigen. Am Neunten des Monats, am
Abend, vom Abend bis zum Abend, sollt ihr euren Sabbat feiern. 3Mo
23,32;
Es gibt hier leider auch viele Bibelübersetzungen, welche diese
jüdische Tageseinteilung nicht berücksichtigen. So übersetzt z.B. Luther mit
"gegen Abend" und auch in den englischen Übersetzungen heißt es bei King
James und RSV "in the evening". Und die NAS übersetzt überhaupt "at
twilight", also in "der Dämmerung".
Nur die Elberfelder Bibel, die englische Darby-Übersetzung und die italienische
Diodati bringen die korrekte Bezeichnung "zwischen den zwei Abenden",
ohne allerdings darauf hinzuweisen, dass dies in der jüdischen Tageseinteilung
eben die Abende zweier unserer Tage sind.
Dabei ist es sehr einfach, diese Aussage zu verifizieren. In 3Mo 23 verkündet
Gott dem Mose jene Feste, welche heilige Versammlungen sind und welche die
Israeliten halten sollen. Und darunter fällt natürlich auch das Passah.
Im ersten Monat, am Vierzehnten des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist Passah dem HERRN.
3Mo 23,4 Dies sind die Feste des HERRN, heilige
Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit: 23,5 Im ersten
Monat, am Vierzehnten des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist
Passah dem HERRN. 23,6 Am fünfzehnten Tag dieses Monats ist das Fest der
ungesäuerten Brote dem HERRN; sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen.
3Mo 23, 4- 6;
Nach Gottes Geheiß ist also das Passah am 14. des Monats,
zwischen den beiden Abenden. Und nun kann man ja nicht davon ausgehen, wenn Gott
sagt: "am Vierzehnten des Monats, zwischen den zwei Abenden", dass er
eigentlich den Abend des 15. des Monats meint. Denn wenn der Abend so zu
verstehen wäre, wie es diese obigen Bibelübersetzungen darstellen, müsste das
nach hebräischer Datierung – ab 18 Uhr – bereits der 15. Nisan sein.
Wie also der obigen Zeittabelle zu entnehmen ist, begann der 14. Nisan nach
unserer Zeit um 18 Uhr unseres Vortages (Dienstag). Dies war auch gleichzeitig
der "erste Abend" dieses jüdischen Tages. Das Gebot aus 2Mo 12,6, die
Schlachtung zwischen den beiden Abenden vorzunehmen, meint also in unserer
Zeitrechnung, das Lamm zwischen 18 Uhr Dienstagabend und 18 Uhr Mittwochabend zu
schlachten.
Und nun haben wir gemäß den Synoptikern folgende Situation: Dienstag abends,
ab 18 Uhr, zu Beginn des 14. Nisan, feierte der Herr mit den Zwölfen das Passah
(Einsetzung des Herrenmahls). Im Anschluss daran gingen sie dann auf den
Ölberg, in den Garten Gethsemane, wo Jesus betete und später in der Nacht die
Festnahme durch die Hohepriester erfolgte. In den folgenden Nachtstunden wurde
Jesus verhört (Verleugnung durch Petrus) und am folgenden Morgen verurteilt und
gegeißelt.
Anschließend war der Gang mit dem Kreuz nach Golgatha und die
Kreuzigung. Um 15 Uhr verstarb der Herr am Kreuz. Danach Kreuzabnahme durch
Josef von Arimathäa und um etwa 18 Uhr, am Ende dieses 14. Nisan, Grablegung in
der Gruft von Josef von Arimathäa. Es war also sowohl die Abendmahlfeier als
auch der Tod Jesu am 14. Nisan, zwischen den zwei Abenden.
Um dieses Missverständnis auszuräumen habe ich die Tabelle weiter oben um die
Abendmahlfeier am Dienstag ergänzt.
Mit Hilfe des sogenannten "Morphing" haben
Wissenschaftler aus dem vagen Abdruck auf dem Turiner Grabtuch ein
lebensnahes Portrait geschaffen, das erstaunlich stark kunsthistorischen
Darstellungen Christi ähnelt. Dieses Foto basiert auf einer achtjährigen
Forschungsarbeit des Briten Dennis Hooper, der das Portrait in einem
dreidimensionalen Computerverfahren (das auch vom FBI verwendet wird)
numerisch rekonstruiert hat.
(Auszug aus der Zeitschrift "Profil" vom 23. 1. 1995)
 |
 |
|
Ob das Turiner Grabtuch echt ist und
wie Jesus Christus tatsächlich ausgesehen hat, ist für uns
gläubige Christen völlig ohne Belang. Wir lieben ihn, weil er
unser Herr, Gott und Erlöser ist. Weil er für uns am Kreuz
gestorben ist, um unsere Sünden vor dem Vater zu sühnen. – Und
weil er auferstanden ist und uns damit den Weg gezeigt hat, den auch
wir gehen werden. |
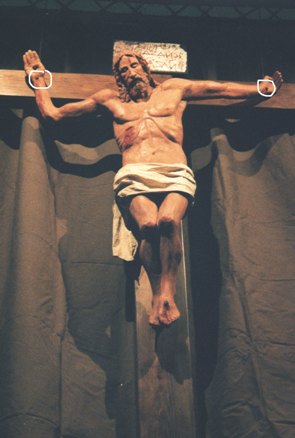 |
Körperbild auf dem Turiner Grabtuch
ist nicht erklärbar / Studie der nationalen italienischen Energie- und
Umweltagentur. (ENEA)
www.parlament.gv.at
https://www.youtube.com/watch?v=-JsJ7Ip3c8s (Das Turiner Grabtuch)